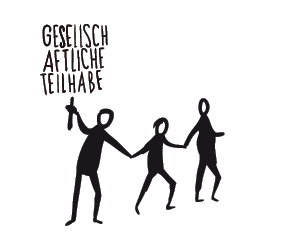Beitrag in der Reihe Perspektiven von der Regionalguppe Berlin des Netzwerks Care Revolution (Dieser Artikel ist in verkürzter Version erschienen in Analyse & Kritik 617.) (Artikel als PDF)

Mit dem neuen ProstSchG werden Sexarbeiter_innen mehr und mehr in die Illegalität getrieben – unsichtbarer und damit noch angreifbarer.
Das sogenannte Prostituiertenschutzgesetz
Ausgerechnet am International Sex Workers’ Day, dem 2. Juni 2016, fand im Bundestag die erste Lesung des geplanten Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG) statt. Wie zahlreiche Prostituierte und Unterstützer_innen vor dem Bundestag deutlich machten, war es ignorant, dass an dem Tag, an dem weltweit Prostituierte auf den Kampf um ihre Rechte aufmerksam machen, das umstrittene Gesetz das erste Mal gelesen wurde. Am 7. Juli wurde das Gesetz verabschiedet. Wieder riefen Prostituierte und Unterstützende zu Protesten vor dem Bundestag auf. Die Regionalgruppe Berlin des Care Revolution Netzwerkes unterstützte die Proteste. Vier Informationsveranstaltungen zum ProstSchG in Berlin und Potsdam waren während des Gesetzgebungsverfahrens von der Netzwerkgruppe organisiert worden. Und im Rahmen eines Abends mit politischen und kulturellen Beiträgen wurde ein gemeinsamer Blick auf Sexarbeit und bezahlte und unbezahlte Pflegearbeit geworfen. Denn Sexarbeit wird von der Regionalgruppe als Care-Arbeit betrachte wenn es z.B. darum geht, Menschen mit Behinderung durch Sexualassistenz überhaupt zu ermöglichen, sexuell aktiv zu sein. Die Frage, die darüber hinaus gestellt werden muss, lautet: Wo fängt Care-Arbeit an wo hört sie auf? Sind also zum Beispiel auch die Dienstleitungen, die man im Bordell kaufen kann, im Bereich der Care-Arbeit anzusiedeln? An diesem Punkt sind sich die Aktiven der Gruppe allerdings nicht einig: Die einen streiten für eine generelle Aufwertung von Sexualität, da sie Sexualität als Teil von menschlichen Grundbedürfnissen ansehen, als einen Aspekt des ‚guten Lebens für alle‘. Andere betrachten es zwar in jedem Fall als legitim, wenn sich Sexarbeiter_innen entschließen im Bordell zu arbeiten, würden aber den Sexarbeitsbereich jenseits der Sexualassistenz nicht per se als Care-Arbeit bezeichnen. Diese und andere Fragen und Widersprüche sollte die oben erwähnte Veranstaltung in der Werkstatt der Kulturen der Welt in Berlin thematisieren. Zudem ging es um Fragen, wie die Auseinandersetzungen im Care-Bereich miteinander verbunden werden könnten, das Sprechen über Gemeinsamkeiten und Unterschiede und einer Aufwertung aller Pflege- und Sorgearbeit zu bewirken.
Beratungsstellen für Sexarbeiter_innen wie move e.V., Hydra e.V., Doña Carmen e.V. und die Berufsverbände BSD e.V. und BesD e.V. etc. kritisieren das Gesetz scharf. Prostituierte sehen sich hier mit einer überholten und bevormundenden Opferrhetorik durch SPD und CDU/CSU konfrontiert, die unterschiedliche Lebensrealitäten von Prostituierten bewusst ausblendet. So geht die Koalition z.B. von einer besonderen Schutzbedürftigkeit von Prostituierten mit Migrationshintergrund aus, die ohne Bildung und berufliche Perspektive nach Deutschland kämen und hier aufgrund ihrer schwachen Position schnell Opfer der sogenannten Sexindustrie würden. Diese Seite der Sexarbeit, nämlich die erzwungene, ist selbstverständlich nicht von der Hand zu weisen und es ist vollkommen klar, dass es diese zu bekämpfen gilt. Dennoch koexistieren freiwillige und erzwungene Sexarbeit nebeneinander. Zwischen diesen beiden Polen gibt es außerdem viele Graustufen und Zwischenschritte. Diese Gleichzeitigkeit zu ignorieren und nicht anzuerkennen, vielmehr zu suggerieren, dass Sexarbeit im Grunde immer ‚falsch‘ sei, ist eine Haltung, die auch antifeministische Züge trägt, da sie berufstätige, selbstständige Frauen entmündigt; ihnen wird erklärt, dass das, was sie tun, eigentlich falsch sei, Sexarbeiter_innen also quasi vor sich selbst geschützt werden müssten.
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE lehnen den Entwurf indes ab. Bis 2002 hatten Prostituierte in der Bundesrepublik übrigens kaum Rechte – so konnten sie z.B. ihren Lohn nicht einklagen. Das hat sich etwas verbessert, als von der rot-grünen Bundesregierung das Prostitutionsgesetz (ProstG) eingeführt wurde. Seitdem sind die Vereinbarungen zwischen Prostituierten und ihren Kund_innen nicht länger sittenwidrig und damit nicht mehr zivilrechtlich unwirksam. Weiter können und sollen die Sexarbeiter_innen in die Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenkasse einzahlen.
… verhindert kollektive Organisierung
Das neue Gesetz sieht vor, dass Prostitutionsstätten, in denen mehr als zwei Menschen arbeiten, eine Gewerbeerlaubnis einholen müssen. Diese Regelung wird zur Folge haben, dass viele Betreiber_innen von kleinen Wohnungsbordellen schließen müssen, da sie die Auflagen (getrennte Sanitärbereiche etc.) zur Anmeldung eines Gewerbes nicht erfüllen können. Neben dieser Erlaubnispflicht für Gewerbestätten greift im Kontext der Bordellbetreibung das Baurecht, das Bordelle als Vergnügungsstätten nur in Kern-, Gewerbe- oder Industriegebieten duldet. Konsequenz wird sein, dass es keine legale Wohnungsprostitution mehr geben wird. Gerade in Wohnungsbordellen haben Sexarbeiter_innen allerdings bislang die Möglichkeit selbstständig, flexibel, ohne Zwang und im Kollektiv mit anderen Prostituierten zu arbeiten. Laut einer Schätzung von Hydra e.V. sind zum Beispiel in Berlin 80% aller Prostitutionsstätten Wohnungsbordelle, die nun größtenteils werden schließen müssen. Großbordelle dagegen werden die Auflagen erfüllen können.
… weitet Kontrolle und Repression aus
Darüber hinaus werden sich Prostituierte neuen Sonderkontrollen durch den Staat unterziehen müssen: Sie müssen sich fortan alle zwei Jahre individuell mit Familiennamen registrieren lassen und die Bestätigung dessen mit sich tragen, quasi einen „Prostituiertenausweis“. Die Daten zur Erstellung des Ausweises werden bei der Behörde gespeichert. Daten über die Sexualität von Personen zu sammeln, ist allerdings brisant, denn wie die Daten durch die jeweiligen Behörden ausreichend geschützt werden sollen, lässt der Entwurf offen. Darüber hinaus ist zu fragen: Wer wird einen „Prostituiertenausweis“ beantragen? Sicherlich werden sich nicht die Prostituierten ohne Papiere, die illegal in Deutschland leben, bei einer Behörde anmelden, denn diese müssten Verhaftungen befürchten. Auch Betroffene von Menschenhandel werden sich nicht anmelden, ebenso wenig die vielen Prostituierten, die in kleinen Bordellen z.B. in der Wohnungsprostitution arbeiten, welche die neuen Voraussetzungen für eine Gewerbeerlaubnis nicht erfüllen können. Auch die Prostituierten in kleineren Städten werden zum Teil auf eine Anmeldung verzichten. Da der Schutz der Anonymität der Großstadt fehlt, droht hier das zwangsweise Outing. Das Hurenstigma wirkt fort. Es ist auch im Jahr 2016 durchaus eine gesellschaftlich anerkannte Praxis, Menschen, die den Beruf der Sexarbeit ausüben, öffentlich zu diffamieren.
Mit dem ProstSchG wird also vor allem eine Verdrängung der Wohnungsprostitution bewusst in Kauf genommen. Prostitution soll fortan explizit in Großbordellen stattfinden und somit besser kontrolliert werden können. Doch das Gegenteil ist zu erwarten. Prostitution wird verstärkt im Verborgenen stattfinden. Wer im Verborgenen arbeitet, ist dem Druck durch Kund_innen und Zuhälter_innen stärker ausgeliefert und ist erpressbarer. So wirkt das Gesetz vor allem repressiv statt ermächtigend auf die Arbeitenden.
Gegenwind bekommt das Gesetz aber auch von Alice Schwarzer und anderen selbsternannten „Abolitionist_innen“, denen der Entwurf in Sachen Sondergesetze für Prostituierte noch zu lasch ausfällt. Ähnlich argumentiert Gunhild Mewis in der Zeitung Analyse und Kritik u.a. für ein generelles Sexkaufverbot und eine Strafverfolgung der Kund_innen. Diese Positionen, die in der Debatte um das Gesetz einige Aufmerksamkeit bekommen haben, zeichnen sich durch eine unrealistische Analyse der vielfältigen Lebensverhältnisse in der Prositution aus. In einer Rhetorik der Pauschalabwertung werden Prostituierte per se entweder als „Überlebende“ (dieses und alle folgenden Begriffe in Anführungszeichen stammen aus dem eben zitierten Artikel von Gundhild Mewes in AK 616) der Prostitution dargestellt oder als „Privilegierte“, die freiwillig dort arbeiten, wo andere gezwungen werden, wie „Sklav_innen“ zu vegetieren. Dabei ist auch die Forderung nach Repressionen gegen Privilegierte rückschrittlich, handelt es sich doch bei den genannten Privilegien nicht selten um erkämpfte Rechte (das Recht auf selbstbestimmtes Ausleben von Sexualität, das Recht, über den eigenen Körper bestimmen zu können, das Recht, freiwillig als Sexarbeiter_in zu arbeiten usw.), die unbedingt für alle gelten sollten. Die Debatte wird sogar bewusst polarisiert, um sich selbst als moralisch ’sauber‘ präsentieren zu können im Gegensatz zu einem vermeintlichen Gegenüber, „den linken Helfern der Sexindustrie“. Mewis und andere scheinen sich somit lieber Schattenkämpfen um die Aufwertung des eigenen Images hinzugeben, als einen tatsächlichen und politischen Realitätscheck zu vollziehen. Eine Bauchnabelschau a là „wer hat die reinere Weste?“ hilft den Sexarbeiter_innen aber nicht weiter.
… verbessert die Lage der Sexarbeiter_innen nicht
Es gibt verschiedene Gründe für Menschen, einer Sexarbeit nachzugehen – oftmals stehen ökonomische Motive, Armut und Perspektivlosigkeit dahinter. Diese Gründe treffen auch auf andere Berufe zu. Die moralisierende Behauptung, dass Prostitution an sich immer ein patriarchaler Akt der Gewalt an Frauen und daher grundsätzlich abzulehnen sei, kann deshalb nicht als Ausgangspunkt in der politischen Auseinandersetzung dienen. Es sollte weniger um Zugehörigkeiten, entsprechende Privilegien und individuelles Schuldbewusstsein gehen, sondern um ungleiche Rechte, die zu diesen Verhältnissen führen. Im Mittelpunkt sollten also Forderungen nach Rechten für Migrant_innen (Arbeitserlaubnis, Bildung etc.) und für Prostituierte, wie die Abschaffung der Sperrbezirksverordnungen, des Prostituiertenausweises und der polizeilichen Sonderrechte, stehen. Dazu müssten grundsätzlich Selbsthilfe, Professionalisierung und mehr bedarfsgerechte Beratungsstellen installiert werden. Zudem ist der starke ökonomische Druck, der tagtäglich auf Menschen lastet, nicht auszublenden. Es ist kein Geheimnis, dass die Stärkung der Rechte von Arbeitenden und die Möglichkeit sich zu organisieren, sich auszutauschen und sich zu beraten, dazu führen, dass weniger Zwang auf Einzelne ausgeübt werden kann. Daher ist neben einer Selbstermächtigung der Prostituierten auch die Stärkung der Position der Prostituierten als Arbeitnehmer_innen durch u.a. die Dienstleitungsgewerkschaft ver.di ein wichtiges politisches Handlungsfeld.
… und muss deshalb zurückgenommen werden
Der Gesetzentwurf wird ab Juli 2017 in Kraft treten. Aus queerfeministischer und linker Sicht, im Interesse der Lohnarbeitenden und im Hinblick auf die informationelle Selbstbestimmung, ist das Gesetz ein Rückschritt hinter die jetzt schon desolate rechtliche Situation von Sexarbeiter_innen. Staatliche Repression und Kontrolle werden die Verhältnisse nicht verbessern. Wir fordern darum Linke und Queerfeminist_innen auf, sich auch weiterhin klar und offensiv gegen dieses Gesetz auszusprechen. Staatliche Repressionen gegen Prostituierte treffen uns alle, wenn zum Beispiel künftig Daten über die Sexualität einer Bevölkerungsgruppe gespeichert werden dürfen – dem gilt es sich entgegenzustellen.
Den Kampf um sexuelle Selbstbestimmung und für die Rechte von Sexarbeiter_innen können wir nur gemeinsam und solidarisch führen und gewinnen.

Der Widerstand gegen die Kriminalisierung von Sexarbeiter_innen wird weitergehen.